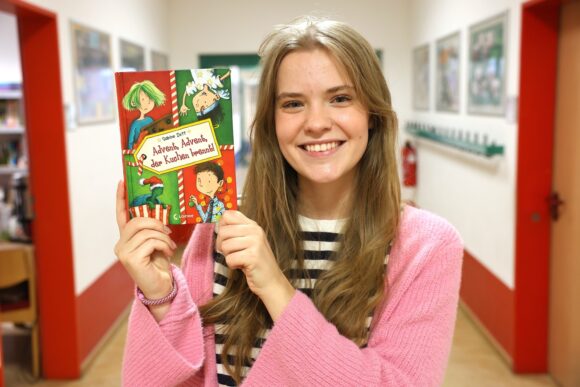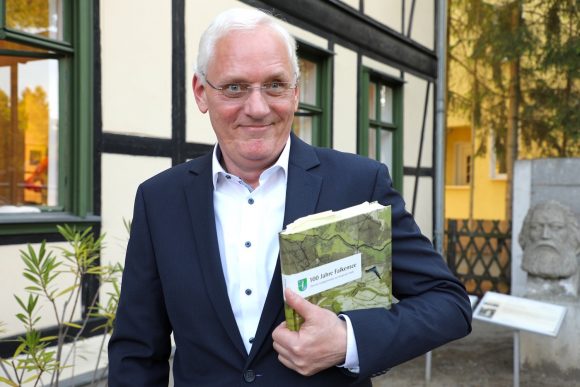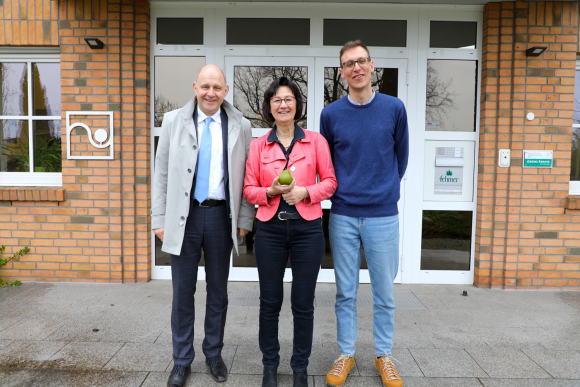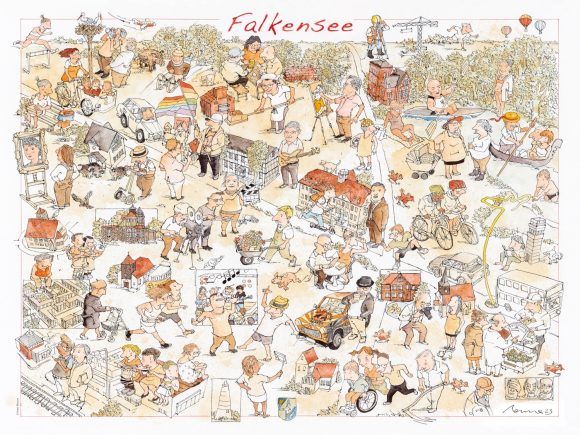Scheibes Glosse: Komm, wir gehen zum Zahnarzt!

Es gibt Menschen, die haben keine Angst vor dem Zahnarzt. Ich gehöre da nicht dazu. Ich habe eine merkwürdige, aus den tiefsten Eingeweiden aufsteigende Furcht vor dem Onkel Doktor. Die natürlich völlig unbegründet ist. Schließlich habe ich mit meinen über 50 Jahren bislang nur kleine Löcher an den Zähnen flicken lassen. Ich weiß aus diesem Grund nur aus Erzählungen, was eine Wurzelkanalbehandlung ist.
Und trotzdem: Sobald ein neuer Zahnarzttermin im Kalender steht, verwandeln sich alle Farben in meinem Alltag in ein düsteres Grau. Es gibt keine Freude mehr in meinem Dasein. Bei jeder verstreichenden Stunde höre ich eine imaginäre Todesglocke läuten. Ich stelle fest, dass ich keine Termine mehr jenseits des anvisierten Zahnarztbesuchs annehme. Und dass ich Freunden emotional danke, dass sie mich so lange auf meinem Weg begleitet haben. Wo ich doch bald ins Licht gehe.
Und dann ist er da, der Tag X. Ich muss an den verrückten Steve-Martin-Zahnarzt aus dem „kleinen Horrorladen“ denken, wenn ich die Praxis betrete. In der Praxis weht ein ganz besonderer Duft durch das Wartezimmer. Ich bilde mir ein, es ist die olfaktorische Essenz der puren Zahnarztpanik, destilliert aus dem Schaumstoffinnenleben alter Zahnarztstühle. Hereingepresst von Patienten, die sich mit ihren Fingernägeln tief im Sessel festgekrallt haben.
Im Wartezimmer habe ich plötzlich alle Zeit der Welt. Ich muss eine halbe Stunde warten? Kein Problem. Ich warte gern auch zehn Stunden. Dabei versuche ich, in der leisen Praxishintergrundmusik Anspielungen auf das Thema Zahn herauszuhören. Lady Gaga singt „Teeth“, Green Day steuert „Pulling Teeth“ bei und Owl City spielt den Song „Dental Care“. Härter wird es schon mit Death Cab for Cutie mit „Crooked Teeth“. Lorde spielt „White Teeth Teens“ und Fischerspooner ist mit „A Kick in the Teeth“ dabei. Ich habe in meinem Leben noch nie Zahnschmerzen gehabt – bei den Songs bekomme ich welche.
Auf dem Zahnarztstuhl habe ich die Angst, dass gleich meine Arme festgeschnallt werden. Aber alles ist gut. Ich werde bemuttert und gehätschelt. Ein Blick an die Zimmerdecke zeigt ein schönes Gemälde. Es soll sicherlich dem Gehirn die Möglichkeit geben, beim Bohren auf andere Gedanken zu kommen. Ich sehe da plötzlich das Szenenfoto eines alten Spaghetti-Westerns. Da hatte ein Cowboy immer Zahnschmerzen und hat sich eine leere Patronenhülse mit Whisky gefüllt und diese dann über den schmerzenden Zahnstummel gestülpt. Dieses Bild habe ich jetzt vor Augen. Plötzlich denke ich, dass dies eine tolle Alternative zum Bohren wäre.
Aber – eine alte Plombe muss raus, eine neue Keramik rein. Meine Frau hatte bereits im Vorfeld abgewunken. Kleinkram, da braucht man ja nicht mal eine Spritze für. Ich möchte am liebsten zehn haben. Aber bitte ohne spitze Nadel. Und ich wünsche mir eine Zahnarzthelferin, die die ganze Behandlung über in mein Ohr flüstert: „Niemals habe ich einen mutigeren Mann gesehen. Das ist unfassbar männlich, wie Sie den fast tödlichen Bohreingriff ertragen und überstehen. Ich wünschte, ich könnte das so einfach wegstecken wie Sie. Andere Männer würden jetzt schon weinen wie ein Kleinkind.“
Dann beginnt das Bohren, das Singen, das Schleifen, das schrille Rumpeln. Auch wenn ich vor meinem inneren Auge das Bild eines schmerbäuchigen Straßenarbeiters mit Presslufthammer in der Hand sehe, so muss ich doch erstaunt feststellen: Schmerzen sind kaum zu spüren, es ist alles nicht so schlimm, wie ich es mir in tausend Tagträumen vorgestellt habe.
Aber da sind noch zwei Gedanken, die ich einfach nicht abstellen kann. Die Zähne sind ja der einzige Teil des Skeletts, der aus dem Körper herausragt und sichtbar wird. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich das Vibrieren des Bohrers auf die Knochen hinter den Zähnen überträgt und dafür sorgt, dass sich plötzlich alle meine Knochen pulverisieren? Und: Während des Eingriffs berechne ich die gesamte Zeit über die aktuelle Entfernung der Bohrerspitze zu meinem kostbaren Gehirn. Sofort schrillt eine Sirene in meinem Gehirn los – der Bohrer ist viel zu nah dran! Alarm!
Und schon ist alles vorbei. In einem halben Jahr sehen wir uns wieder? Na klar, das ist überhaupt gar kein Problem! Ich bin doch kein Angsthase! (CS, Foto: Tanja M. Marotzke)
Dieser Artikel stammt aus „FALKENSEE.aktuell – Unser Havelland“ Ausgabe 161 (8/2019).
Seitenabrufe seit 1.12.2021:
Kennen Sie schon unsere Gratis-App?
Apple – https://unserhavelland.de/appapple
Android – https://unserhavelland.de/appandroid
Anzeige